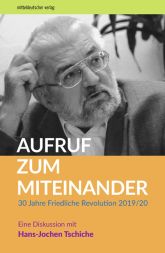Der Experte für griechische Sprache
Seit 2013 gelangt man nicht mehr durch die Sitznischenpforte des alten Wohnhauses von Philipp Schwarzerdt alias Melanchthon in das Museum, sondern durch die Glastür des modernen Anbaus, dessen graue Fassade wenig einladend wirkt. Die Räume innen sind zweckmäßig gestaltet und so informieren auf 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche zahlreiche Schrifttafeln, Gemälde und Handschriften über Melanchthons Lebensverhältnisse und Wirkung. Sie belegen seine Bedeutung für die Reformation und für die Entwicklung des Protestantismus. In den Ausstellungsräumen erfährt man unter anderem auch, dass Melanchthon sich bewusst gesund ernährte. Den exzessiven Fleischverzehr seiner Zeitgenossen teilte er nicht.
Zur Namensgebung Melanchthon kam es durch die altgriechische Übertragung seines Familiennamens Schwarzerdt. Für die griechische Sprache hatte er bereits als Jugendlicher ein Faible. Mit 13 Jahren wurde er Student an der Universität in Heidelberg, wechselte nach Tübingen und war mit 17 schon Magister. Mit 21 Jahren kam Melanchthon nach Wittenberg und wirkte fortan hier und weit über Wittenberg hinaus: sowohl für die Reformation als auch für die Verbesserung des Hochschulwesens. Letzteres brachte ihm den Titel „praeceptor Germaniae“ (Lehrer Deutschlands) ein. Unter den ca. 2.000 von Melanchthon verfassten Schriften ragt die „Confessio Augustana“ von 1530 hervor. Dieses „Augsburger Bekenntnis“ ist ein Basistext der Reformation und eine wichtige Grundlage der lutherischen Kirchen.
Das Haus von Melanchthon lag günstig, denn die Universität Leucorea, in der er als höchstdotierter Professor lehrte, befand sich gleich nebenan. Es kostete fast 1.000 Gulden. Melanchthons Anfangsgehalt betrug 100 Gulden pro Jahr. Somit galt bereits damals ein Verhältnis, das heute noch für einen Hauskauf gilt: etwa das Zehnfache eines soliden Jahreseinkommens. Einen größeren Teil der Summe übernahm Kurfürst Johann Friedrich und auch die Universität zahlte einen Anteil. Zu dem 14 Jahre älteren Martin Luther, der ebenfalls nahebei wohnte und die Bücher Melanchthons mehr schätzte als die eigenen, hegte Philipp Melanchthon eine freundschaftliche Beziehung. Beide Männer wurden jeweils 63 Jahre alt.
*****
Textquelle:
Tietke, Mathias: Wittenberg - die 99 besonderen Seiten der Stadt, Halle: Mitteldeutscher Verlag, 2015.
Bildquelle:
Mathias Tietke.